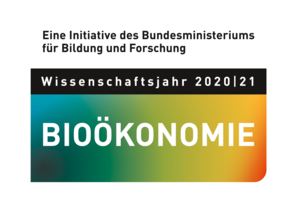im Wissenschaftsjahr 2020/21 - Bioökonomie
Neue Gedankenräume erobern.
Wie genau funktioniert das mit dem Bioplastik aus Algen, Obstrückständen oder Maisstärke? Ist Gentechnik wirklich so schlecht, wie immer behauptet wird? Wie können wir es schaffen, eine umwelt- und klimafreundliche Ernährung für alle erschwinglich zu machen? Und wer oder was ist diese Bioökonomie eigentlich?
Bei den Science Slam-Talks im Wissenschaftsjahr 2020/21 - Bioökonomie setzen wir uns mit unseren Gästen und ihrer Forschung auseinander. Wir räumen mit Vorurteilen auf, geben euch Wissen auf den Weg und stellen spannende Forschungsfelder der Bioökonomie vor. Hier sind Science Slammer*innen und die, die es noch werden wollen, zu Gast und erzählen, mit was sie sich abseits der Wettbewerbe beschäftigen. Dabei geht es um Forschung zu Prozessen und nachhaltigen Produkten oder um gesellschaftliche Fragen und Antworten, die eine Bioökonomie mit sich bringt. Schaltet ab sofort ein auf dem YouTube-Kanal des Haus der Wissenschaft!
Das Projekt wird im Wissenschaftsjahr 2020/21 - Bioökonomie gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Die Science Slam-Talks werden zusammen mit den Science Slams im Wissenschaftsjahr, 2021 durchgeführt.
Klicken Sie auf die Verlinkungen, um Informationen zu unseren weiteren Projekten im Wissenschaftsjahr 2020/21 - BioEconomyNow!, Science Slam im Wissenschaftsjahr, Science Watch Parties und Virtuelle Landwirtschaft - zu bekommen.
Weitere Informationen zum Wissenschaftsjahr 2020/21 gibt es hier.